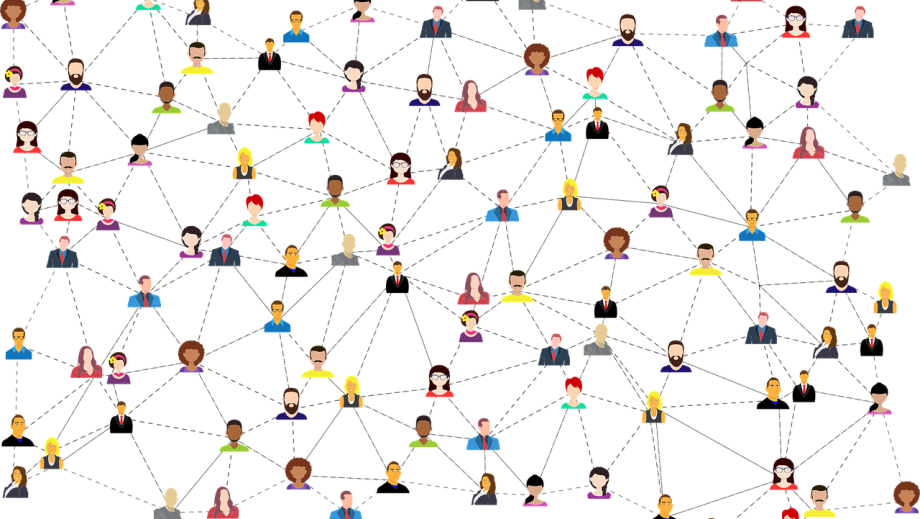
Berichte Städtereisen in der Woche
Villa Hügel und Rundfahrt auf dem Baldeneysee am 25. Juni 2024
Für Ende Mai 2024 hatten wir bereits die jetzige Fahrt nach Essen mit dem Besuch der Villa Hügel und einer Rundfahrt auf dem Baldeneysee geplant. Diese mussten wir jedoch wegen des zu diesem Zeitpunkt kalten und regnerischen Wetters und der weiteren ungünstigen Wetterprognose leider absagen. Deshalb beschlossen wir bei unserem Stammtisch im Juni, diese Fahrt kurzfristig nachzuholen, was sich als eine gute Entscheidung herausstellte. Und so machten wir uns dann am 25. Juni mit 17 Netzwerkern auf den Weg nach Essen. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel, und auch die Temperaturen hatten sich der Jahreszeit angepasst.
Unser erstes Ziel war die Villa Hügel. Das schlossähnliche Gebäude war in den Jahren 1870 – 1873 im Auftrag von Alfred Krupp errichtet worden und diente der Familie Krupp bis 1945 als Wohnsitz, aber auch zu Repräsentationszwecken. Heute ist es Sitz der „Historischen Ausstellung Krupp“, wo wir uns in verschiedenen frei zugänglichen Räumen über die Geschichte der Familie und des Unternehmens Krupp informieren konnten. Auch der 28 Hektar große Park, der zu dem Anwesen gehört, ist sehr sehenswert. Dort waren wir insbesondere von einigen Bäumen sehr beeindruckt, deren Stämme wegen ihres großen Umfangs nur von mehreren Personen gleichzeitig umfasst werden können, was einigen unserer Teilnehmerinnen wiederum ein großes Vergnügen bereitete.
Nach dem Besuch der Villa Hügel stand eine Rundfahrt mit der Weißen Flotte Essen auf dem Baldeneysee auf unserem Programm, wo wir auf dem Oberdeck der „Stadt Essen“ die herrliche Umgebung genießen konnten. Die Fahrt ging vorbei an dem erhaltenen Förderturm der ehemaligen Zeche „Carl Funke“ in Heisingen, vorbei an Kupferdreh und dem Haus Scheppen, dem Ausgangspunkt der Museumsbahn Hespertalbahn, und endete nach 2 Stunden wieder am Anleger unterhalb der Villa Hügel. Wegen des sommerlichen Wetters war das Oberdeck derart stark frequentiert, so dass es dem Servicepersonal leider nicht überall gelang, die bestellten Getränke rechtzeitig zu servieren, was allerdings der Stimmung keinen Abbruch tat.
Danach fuhren wir weiter in den benachbarten Stadtteil Essen-Werden, der eine S-Bahn-Station von der Villa Hügel entfernt liegt. Werden wird von der Basilika St. Ludgerus überragt, deren Ursprung auf die Zeit um das Jahr 800 zurückgeht, als der damalige friesische Missionar und spätere erste Bischof von Münster Luidger hier ein Benediktinerkloster gründete. Luidger oder Ludgerus wurde später heiliggesprochen, und sein Schrein befindet sich in der Krypta der Basilika. Wegen des heißen Wetters verzichteten wir allerdings auf einen Besuch der Kirche. In dem historischen Zentrum von Werden fanden wir dann ein schönes Café, wo wir uns dann in einer gemütlichen Runde erfrischen und unseren Ausflug abschließen konnten.
Manfred Winkler
Bilder: Irmgard Monderkamp, Roswitha Nieschulze, Manfred Winkler
Fahrt zum Gasometer in Oberhausen am 23. April 2024 mit Besuch der Ausstellung „Planet Ozean“
In unserer Gruppe gehört es inzwischen zu einer schönen Tradition, die Ausstellungen im Gasometer in Oberhausen zu besuchen. Und so machten wir uns am 23. April wieder auf den Weg zu der derzeit stattfindenden Ausstellung „Planet Ozean“. Obwohl wir bei den Vorbereitungen darauf hingewiesen worden waren, dass wir uns auf eine sehr große Besucherzahl und lange Wartezeiten an der Kasse einstellen müssten, zeigte es sich, dass wir den Termin für die Fahrt richtig gewählt hatten. Innerhalb von wenigen Minuten hatten wir unser Gruppenticket erhalten, und unsere Gruppe wurde auch durch einen separaten Eingang auf das Gelände des Gasometers eingelassen, so dass wir unser Ziel problemlos und ohne Verzögerungen erreichen konnten.
In den verschiedenen Bereichen der Ausstellung wird anhand von großformatigen Fotografien und Filmen die Fauna und Flora der Ozeane gezeigt. So bewegt sich zum Beispiel ein Harlekin-Oktopus durch eine Lagune. Es gibt direkten Blickkontakt mit einem Blauhai, ein Seelöwe beobachtet einen Fetzenfisch, oder es gibt auch einen Einblick in einen Kelpwald aus Seetang, der einer Vielzahl von Fischen Lebensraum bietet.
In einem eigens für die Ausstellung entwickelten Raumobjekt „Klang der Tiefe“ ist es den Besuchern möglich, einzigartige Klangwelten wahrzunehmen, wenn tausende kleinster Krustentiere, lebendige Korallenriffe oder ein Schwarm Kabeljaue belauscht werden können.
Höhepunkt der neuen Schau „Planet Ozean“ ist die Inszenierung „Die Welle“ im oberen Luftraum des Gasometers. Hier dient eine 40 Meter hohe und 18 Meter breite Leinwand als Projektionsfläche für eine fotorealistisch animierte Meereswelt. Hier können die Besucher auf Augenhöhe mit Walen, Fischen oder auch Quallen den Ozean ergründen.
Es wird jedoch auch auf die Belastung der Weltmeere durch die zunehmende Handelsschifffahrt, aber insbesondere auch durch den Klimawandel, hingewiesen. So zeigen Satellitenbilder der NASA einen enormen Eisverlust in Grönland. Was die Klimaschützer entsetzt, erfreut andererseits die Spekulanten. Denn unter dem Eis werden enorme Vorkommen an Mineralien, Erzen, Gold und Edelsteinen vermutet. Ferner sollen die für den Antrieb von Elektrofahrzeugen wichtigen Elemente wie Nickel und Kobalt hier in großen Mengen vorhanden sein, was wiederum Begehrlichkeiten bei internationalen Bergbauunternehmen und Investoren weckt. Da auch verschiedene Länder dabei eigene Interessen verfolgen, könnte so möglicherweise ein nicht unerhebliches Konfliktpotential entstehen.
In den wenigen Stunden konnte man selbstverständlich keinen vollständigen Überblick über die gesamte Ausstellung gewinnen. Sie bot allerdings für jeden von uns sicherlich viele interessante und neue Einblicke in eine Welt, für deren Schutz noch ein erheblicher Aufwand erforderlich sein wird.
Ein anschließender Besuch auf der Gastronomiemeile der Neuen Mitte rundete unseren wieder einmal sehr interessanten Ausflug ab.
Manfred Winkler
Fahrt nach Mainz am 19. März 2024
Eine Fahrt nach Mainz mit dem Besuch des Sendezentrums des Zweiten Deutschen Fernsehens hatten wir bereits für das Frühjahr 2020 vorgesehen. Leider mussten wir damals wegen der Corona-Pandemie unser Vorhaben kurzfristig absagen.
Aufgegeben hatten wir diesen Plan allerdings nicht. Und so beschlossen wir, die lange zurückgestellte Fahrt in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz am 19. März 2024 zu verwirklichen. Da sich auch alle Teilnehmer pünktlich zur Abfahrt eingefunden hatten, konnte sich unser Bus wie vorgesehen um 8.00 Uhr in Bewegung setzen. Und da sich unterwegs die Verkehrsverhältnisse als günstig erwiesen, erreichten wir bereits kurz vor 11.00 Uhr unser erstes Ziel, die Innenstadt von Mainz.
Das beherrschende Bauwerk der Mainzer Altstadt ist der Dom, die Bischofskirche der römisch-katholischen Diözese Mainz. Der Bau ist in seiner heutigen Form eine dreischiffige romanische Pfeilerbasilika, die in ihren Anbauten auch gotische und barocke Stilelemente aufweist. Das Innere des Doms ist durchaus sehenswert. Es wirkte auf uns jedoch, nicht zuletzt wegen des bedeckten Himmels an diesem Tag, sehr dunkel.
Eine besondere Attraktion war der Wochenmarkt auf dem Domplatz. Die vielen bunten Stände mit ihrem Angebot an Obst, Gemüse und lokalen Spezialitäten sowie der österliche Schmuck boten eine sehr schöne Atmosphäre, die viele von uns zum Verweilen einlud. Unser weiterer Weg durch die Altstadt führte uns dann am Denkmal von Johannes Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, und am Gutenberg-Museum vorbei.
Eine besondere Sehenswürdigkeit ist die Kirche St. Stephan am Rande der Altstadt. Einzigartig in Deutschland sind die Fenster dieser Kirche, die von dem jüdischen Künstler Marc Chagall geschaffen wurden, der sie als Beitrag zur jüdisch-deutschen Aussöhnung verstanden wissen wollte. Es gelang dem damaligen Pfarrer von St. Stephan, Chagall als Künstler zu gewinnen. Wie man einer Information der Mainzer Touristik entnehmen kann, pilgern jährlich etwa 200.000 Besucher hinauf zur Stephanskirche, um die berühmten Fenster zu betrachten. Auch auf uns hinterließen die blau leuchtenden Fenster einen tiefen Eindruck.
Nach dem Besuch der Mainzer Innenstadt fuhren wir weiter zum Sendezentrum des Zweiten Deutschen Fernsehens, das in dem Stadtteil Lerchenberg angesiedelt ist. Bei einer Führung durch das Sendezentrum hatten wir die Gelegenheit, das Gelände kennen zu lernen, von dem an den Sommersonntagen die Livesendung „Fernsehgarten“ übertragen wird. Weiterhin besuchten wir das bereits sendefertige Studio für die Sendung „Hallo Deutschland“. Im Rahmen dieser Führung wurde uns auch erläutert, welcher hohe technische Aufwand erforderlich ist, damit dem Zuschauer zu Hause über die Bildregie und über die Beleuchtung im Studio ein klares und schattenfreies Bild geliefert wird. Wahrscheinlich wird mancher von uns nach diesem Besuch die eine oder andere Fernsehsendung künftig mit anderen Augen betrachten. Zum Abschied erhielten wir noch ein Andenken: eine Postkarte mit Stickern, auf denen die wohl bekanntesten Mitarbeiter des ZDF, die Mainzelmännchen, abgebildet sind.
Auch unsere Rückfahrt verlief trotz des Feierabendverkehrs ohne Probleme, so dass wir wohlbehalten wieder gegen 20.00 Uhr zu Hause ankamen. An dieser Stelle noch ein Dankeschön an den Busfahrer und das Busunternehmen, das uns wieder einen sehr guten und bequemen Reisebus zur Verfügung gestellt hatte.
Manfred Winkler
Bilder: Irmgard Monderkamp, Edeltraud Walder, Georg Beier, Manfred Winkler
Fahrt zum Parkleuchten im Grugapark Essen am 20. Februar 2024
Das Parkleuchten im Grugapark in Essen hat sich im Ruhrgebiet seit mehreren Jahren zu einer besonderen Attraktion in der Winterzeit entwickelt, die jährlich viele Besucher anlockt. Deshalb war das Parkleuchten auch für uns wieder das Ziel unseres ersten Ausflugs in diesem Jahr.
Die Lichtkünstler hatten sich wieder viel Neues einfallen lassen. So waren viele eindrucksvolle Lichtszenarien entstanden, wie zum Beispiel hunderte von mehrfarbigen Tulpen, die auf den Frühling einstimmen sollten, oder auch hängende Früchte und Quallen in den Bäumen. An einigen interaktiven Stationen konnten die Besucher selbst mit dem Licht spielen. Zudem waren auch wieder die Bäume, Sträucher und Wege im Park bunt illuminiert. Und da das regnerische Wetter der letzten Tage eine Pause eingelegt hatte, hatten sich an diesem Abend sehr viele Besucher auf den Weg in den Grugapark gemacht.
Mit den beigefügten Bildern möchten wir versuchen, einen möglichst großen Überblick zu vermitteln, und dennoch können wir nur einen kleinen Teil der vielfältigen Eindrücke wiedergeben. Das Parkleuchten hat uns auch in diesem Jahr wieder sehr beeindruckt, und so waren sich hinterher nicht nur die Hobbyfotografen unter uns einig, dass sich auch dieser Ausflug wieder gelohnt hat.
Manfred Winkler
Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Hattingen am 19. Dezember 2023
Das Ziel unseres letzten Ausflugs im .Jahr 2023 war der Weihnachtsmarkt in Hattingen. Trotz des Dauerregens an diesem Tag machten wir uns dennoch mit 18 Netzwerkern auf den Weg, wobei wir übereinstimmend der Ansicht waren, dass Schnee anstelle des Regens doch mehr in die Vorweihnachtszeit gepasst hätte.
Leider mussten wir unterwegs erneut feststellen, dass es vielleicht hilfreich wäre, wenn sich der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und die Deutsche Bahn auf eine einheitliche Fahrplanauskunft einigen könnten. Deshalb verzögerte sich infolge einer nicht angekündigten Streckensperrung wegen einer Baustelle sowie wegen eines Personalausfalls unsere Ankunft in Hattingen um etwa eine Stunde, was der Stimmung allerdings keinen Abbruch tat.
In der malerischen Altstadt von Hattingen besichtigten wir zunächst die bereits weihnachtlich geschmückte St.-Georgs-Kirche mit ihrer Sternendecke. Danach schloss sich ein Bummel vorbei an den Buden des Weihnachtsmarktes an. An der Fassade des historischen Rathauses war wie in jedem Jahr ein Adventskalender angebracht, an dem Frau Holle dann das 19. Türchen öffnete, für die leider wenigen Kinder ihre Betten schüttelte und damit zumindest die Illusion von Schnee aufkommen ließ.
Die Bilder, die diesem Bericht beigefügt sind, dürften trotz des Regenwetters einiges von der Stimmung wiedergeben, die dieser sehr schöne Weihnachtsmarkt vermittelt.
Ein Cafébesuch in fröhlicher Runde bildete den Abschluss des Besuchs in Hattingen und unserer Fahrten im Jahr 2023. Für das kommende Jahr wünschen wir uns, dass wir uns gesund und wohlbehalten wiedersehen und erneut unterwegs sein dürfen.
Manfred Winkler
Bilder: Ellen Kircher, Marlies Loges, Roswitha Nieschulze, Edeltraud Walder
Besichtigung des Mercedes-Benz Werk in Düsseldorf
am 28. und 30. November 2023
Im Frühjahr wurde bekannt, dass das Mercedes-Benz Werk in Düsseldorf Besichtigungen anbieten würde, woraufhin wir beschlossen, eine entsprechende Anfrage zu stellen. Unsere Anfrage wurde von Mercedes-Benz auch direkt positiv beantwortet. Da die Führungen jedoch sehr gefragt sind und aus Sicherheitsgründen maximal 15 Personen zugelassen werden, konnte uns erst für den Monat November ein Besuchstermin angeboten werden. Und wegen der hohen Teilnehmerzahl mussten wir in zwei Führungsgruppen jeweils für den 28. und den 30. November aufgeteilt werden.
Zunächst erhielten wir im Besucherzentrum einige Informationen über Mercedes-Benz im Allgemeinen sowie über das Werk im Besonderen. Es wurde im Jahr 1962 gegründet und beschäftigt rund 5.600 Mitarbeiter. Im Werk werden alle geschlossenen Varianten des Mercedes-Benz Sprinter hergestellt. Es ist somit das weltweit größte Transporter-Werk der Mercedes-Benz Gruppe. Dabei wurde auch mit einem interessanten Vergleich aufgewartet: Mit dem jährlichen Verbrauch an Eisen und Stahl im Werk Düsseldorf könnte der Eiffelturm in Paris mehrfach erneut aufgebaut werden.
Der erste Teilbereich unseres Besuchs war der Rohbau. Hier konnten wir die Herstellung, angefangen von den Einzelteilen für das Chassis bis zur fertigen Karosserie, verfolgen. Die einzelnen Arbeitsschritte werden dabei weitestgehend durch Roboter durchgeführt. Interessant war es zu erfahren, dass für jedes Fahrzeug bereits eine Kundenbestellung vorliegt. Es wird also nicht „auf Halde“ produziert. Vielmehr wird jedes einzelne Fahrzeug exakt den Wünschen des Kunden entsprechend gefertigt, z. B. die Höhe des Daches, Links- oder Rechtssteuerung. Nach dem Rohbau gehen die Karosserien in die Lackiererei, wo sie die vom Kunden bestellte Farbgebung erhalten.
Danach erfolgt die Weiterbearbeitung in der Montage, dem zweiten Teilbereich unserer Führung. Hier erfolgen weitere Einbauten wie z. B. das Einsetzen der gewünschten Windschutzscheiben, der Scheinwerfer und der Rücklichter sowie der Armaturenbretter. An großen Bildschirmen über den einzelnen Arbeitsbereichen lassen sich die Soll-Vorgaben der Produktion und der jeweilige Ist-Zustand verfolgen. Wie wir zu unserem großen Erstaunen erfuhren, ermöglichen die weitestgehend automatisierten Arbeitsabläufe, dass ein komplettes Fahrzeug in lediglich 27 Arbeitsstunden fertiggestellt werden kann.
Im Werk sind Aufnahmen nicht gestattet, deshalb ist es uns leider nicht möglich, diesem Bericht Bilder von der hochinteressanten Werksbesichtigung beizufügen.
Ein anschließender kurzer Abstecher in die Düsseldorfer Altstadt rundete danach für jede Besuchergruppe einen wieder sehr schönen und interessanten Tag ab.
Manfred Winkler
Fahrt nach Rhöndorf am 26. Oktober 2023
Am 26. Oktober 2023 waren wir wieder unterwegs. Das Ziel der 19 Netzwerker war dieses Mal Rhöndorf am Rhein. Erfreulicherweise legte das regnerische Herbstwetter an diesem Tag eine Pause ein, so dass die vorsichtshalber mitgebrachten Regenschirme in den Taschen bleiben konnten.
Rhöndorf, das heute ein Ortsteil von Bad Honnef ist, war von 1937 bis 1967 der Wohnsitz von Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland. Sein Wohnhaus liegt oberhalb des Ortes, und man hat von dort einen herrlichen Blick auf den Drachenfels und hinunter zum Rhein. Die privaten Wohnräume können nur mit einer Führung besichtigt werden. Leider war es uns nicht möglich, eine solche Führung mitzumachen, da die Vorlaufzeiten für die Anmeldungen sehr lang sind. Dafür hatten wir jedoch die Gelegenheit, das im Eingangsbereich befindliche Museum mit der Dauerausstellung „Konrad Adenauer 1876 – 1967, Rheinländer – Deutscher – Europäer“ zu besuchen. Diese Ausstellung vermittelt die Biographie des ersten deutschen Bundeskanzlers anhand von Fotografien, Objekten, Filmen und Medienstationen. So war er unter anderem als Kölner Oberbürgermeister während der Weimarer Republik mit 41 Jahren der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt, bis er 1933 von den Nationalsozialisten seines Amtes enthoben wurde. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde er 1949 mit einer Stimme Mehrheit zum ersten Bundeskanzler der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland gewählt. Aus dieser Zeit sind etliche Kopien von verschiedenen Dokumenten und von Briefwechseln innerhalb der damaligen Regierung ausgestellt. Darin werden unter anderem auch Themen angesprochen, die heute so gut wie gar nicht mehr bekannt sind. So ist ein Schreiben Adenauers an seinen Wirtschaftsminister Professor Ludwig Erhard zu sehen, in dem er sich ausdrücklich dagegen ausspricht, dass die Renten auf das Niveau der Sozialhilfe abgesenkt werden sollten. Daraus könnte man beinahe entnehmen, dass der „Vater des Wirtschaftswunders“, wie Ludwig Erhard bis heute gern genannt wird, diesem Vorschlag aus den Reihen der Arbeitgeberverbände nicht gerade ablehnend gegenüberstand. Der Wahlkampf in den 1950er Jahren wird ebenfalls in der Ausstellung behandelt. Dabei ist die wirtschaftliche Entwicklung in der neuen Bundesrepublik ein wesentliches Thema. Auch die Erinnerung an die Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten wird dahingehend angesprochen, dass die Menschen jetzt in der Bundesrepublik in Freiheit leben können, ein neues Zuhause gefunden haben und von dem wirtschaftlichen Aufschwung profitieren. Diese Punkte wurden unter dem Stichwort „Keine Experimente“ zusammengefasst, wovon sich auch viele Wähler angesprochen fühlten und die CDU mit Konrad Adenauer an der Spitze die absolute Mehrheit im Bundestag erhielt.
Insbesondere sind aber die Bestrebungen um die Aussöhnung mit Frankreich ein wesentlicher Bestandteil der Ausstellung. Dank der Bemühungen Konrad Adenauers und des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle hat sich seitdem zwischen Deutschland und Frankreich ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Im Garten des Hauses stehen zur Erinnerung daran Statuen der beiden großen Staatsmänner.
Nach der Besichtigung der Ausstellung und des sehr schönen Gartens fuhren wir weiter in das wenige Minuten entfernte Bad Honnef, wo mit einem Besuch des dort stattfindenden Martinimarktes unsere Fahrt ihren Abschluss fand.
Manfred Winkler
Bilder: Heidi Haby, Ellen Kircher, Irmgard Monderkamp, Ursula Niermann, Christa Schneider, Doris Winkler, Manfred Winkler
Hafenrundfahrt in Duisburg-Ruhrort am 21. September 2023
Bei unserem Ausflug am 21. September 2023 blieben wir in unserer Stadt und unternahmen eine seit längerem geplante Hafenrundfahrt. Dabei wurde uns im Voraus empfohlen, anstatt mit der „Weißen Flotte“, die ihre Fahrten am Schwanentor beginnt, mit der kleineren M/S „Rheinfels“ ab der Schifferbörse in Duisburg-Ruhrort zu fahren.
Dass dieses eine sehr gute Empfehlung war, stellte sich bald heraus. Am Steiger Schifferbörse waren unsere Gruppe, die dieses Mal 22 Netzwerker umfasste, und einige weitere Gäste an Bord gegangen. Nachdem am Eisenbahn-Bassin noch 2 weitere Fahrgäste zugestiegen waren, begann die eigentliche Rundfahrt. Zunächst erfuhren wir, dass die Friedrich-Ebert-Brücke, die Ruhrort mit Homberg verbindet, nach dem zweiten Weltkrieg in den Jahren 1951 bis 1954 errichtet worden war. Die Vorgängerbrücke aus dem Jahr 1907 war im März 1945 von deutschen Truppen auf ihrem Rückzug gesprengt worden. Zuvor gab es lediglich eine Trajekt-Verbindung, da der preußische Staat bis dahin aus militärischen Gründen die Genehmigung für eine Brücke verweigert hatte.
Dann ging es über Rhein an der Binnenschifferschule im Hafen von Homberg vorbei und zurück in die Ruhrorter Hafenbecken. Der Schiffsführer erläuterte mit launigen Worten die einzelnen Bereiche wie beispielsweise die Kohleninsel und die Schrottinsel, aber auch den Freihafen-Bereich. Der Hafen wird im Rahmen des Strukturwandels derzeit ständig zu einer überregionalen „Logistik-Drehscheibe“ weiterentwickelt, so dass das Containerterminal in einigen Jahren der größte Umschlag-Platz in den europäischen Binnenhäfen sein wird.
Daneben gibt es im Hafen auch einige Kunstwerke zu sehen. Dort wo die Ruhr in den Rhein mündet, erhebt sich eine 25 Meter hohe und 7 Meter breite Skulptur, die den Namen „Rheinorange“ trägt. Mit der leuchtend orangefarbenen Skulptur soll eine rotglühende Bramme dargestellt werden, die für die Stahlproduktion in Duisburg steht. Dann wurden wir auch auf die von dem Bildhauer Markus Lüpertz geschaffene 5 Meter hohe Büste des griechischen Meeresgottes Poseidon auf der Mercatorinsel hingewiesen. An der Mühlenweide steht die Statue des heiligen Nikolaus, des Schutzheiligen der Schiffer. Und am Vinckekanal machte uns unser Schiffsführer auf die Kunstboote aus Beton aufmerksam, die in den Jahren 1993 bis 1995 entstanden sind. Man konnte seine Erklärung gut nachvollziehen, dass sowohl die Büste des Poseidon, die Nikolaus-Statue als auch die Kunstboote bis zum heutigen Tag polarisieren.
Wie bereits erwähnt, war die Fahrt mit der „Rheinfels“ eine sehr gute Wahl. Die launigen Erklärungen des Schiffsführers wurden nie langweilig, so dass man beim Verlassen des Schiffs den Eindruck gewonnen hatte, gleichzeitig gut informiert und gut unterhalten worden zu sein. Eine Fahrt mit der „Rheinfels“ ist daher auf jeden Fall zu empfehlen.
Ein anschließendes gemütliches Kaffeetrinken im Café Kurz beendete dann unseren Aufenthalt im Hafenstadtteil Ruhrort.
Manfred Winkler
Bilder: Roswitha Nieschulze, Ellen Kircher, Ursula Niermann, Manfred Winkler
Fahrt zum Wasserschloss Nordkirchen am 2. August 2023
Für den 2. August 2023 hatten wir einen Ausflug zum Wasserschloss Nordkirchen im Münsterland beschlossen. Leider zeigte sich das Wetter in diesen Tagen nicht von seiner allerbesten Seite, und die Fahrt drohte buchstäblich ins Wasser zu fallen. Angesichts des andauernden Regenwetters gab es auch etliche Absagen, aber mehrere „Hardliner“ entschieden sich dafür, sich von der Wettervorhersage nicht abschrecken zu lassen und dennoch zu fahren. Und so machten wir uns trotz des wolkenverhangenen Himmels mit 14 Unentwegten auf den Weg ins Münsterland.
Auch die Deutsche Bahn erwies sich auf der Hinfahrt nicht gerade als zuverlässig. Obwohl wir nach dem Fahrplan noch genügend Zeit zum Umsteigen in Dortmund gehabt hätten, erreichten wir unseren Anschluss leider nicht mehr. Deshalb mussten wir einen Umweg über Lüdinghausen in Kauf nehmen und lernten damit noch eine Gegend des Münsterlandes kennen, die wir eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt hatten. Aber immerhin kamen wir so noch pünktlich zu unserer gebuchten Schlossführung in Nordkirchen an.
Mit dem Bau des Schlosses wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts begonnen. Es war seinerzeit eines der am stärksten befestigten Wasserschlösser des Münsterlandes. Nachdem die männliche Linie des Vorbesitzers ausgestorben war, wurde es 1694 an Friedrich Christian von Plettenberg, den Fürstbischof von Münster, verkauft. Das Schloss sollte nach seinem Wunsch zu einem Sommersitz nach dem Vorbild des Schlosses von Versailles umgebaut werden. Die Umgestaltung erfolgte in den Jahren 1703 – 1734. Auf Grund seiner Größe und seiner Schönheit führt das Schloss Nordkirchen auch den Beinamen „Westfälisches Versailles“.
1949 wurde das Schloss von dem damaligen Besitzer zum symbolischen Preis von einer Deutschen Mark pro Jahr an das Land Nordrhein-Westfalen vermietet. Im Gegenzug verpflichtete sich das Land, Renovierungsarbeiten an dem inzwischen sehr desolaten baulichen Zustand vorzunehmen. Heute beherbergt das Schloss die Finanzhochschule des Landes Nordrhein-Westfalen und ist darüber hinaus nach Abschluss der zahlreichen Renovierungen ein beliebtes Ausflugsziel im Münsterland.
Wie wir von unserem Schlossführer erfuhren, ist das Schloss Nordkirchen auch ein beliebter Ort zum Heiraten. Insbesondere an Tagen, die auf ein besonderes Datum fallen, wie beispielsweise eine Zahlengleichheit von Tag, Monat oder auch dem Jahr, finden dort Trauungen beinahe rund um die Uhr statt. Auch die Schlosskapelle, in der unsere Führung begann, wird gerne für kirchliche Trauungen genutzt.
Nach der Schlossführung hatte es erfreulicherweise aufgehört zu regnen, so dass wir die Gelegenheit hatten, die Schönheit des Schlosses und seiner Umgebung vorübergehend bei strahlend blauem Himmel genießen zu können, und damit boten sich auch einige sehr schöne Fotomotive. Während der Rückfahrt wurde deshalb auch mehrfach der Wunsch geäußert, diesen Ausflug bei einer stabileren Wetterlage zu wiederholen.
Manfred Winkler
Bilder: Heidi Haby, Irmgard Monderkamp, Renate Müller, Manfred Winkler
Unsere Fahrt nach Trier am 27. Juni 2023
Nachdem wir im Mai 2017 mit unserer Reisegruppe schon einmal Trier besucht hatten, wurde des Öfteren der Wunsch geäußert, nochmals eine Fahrt in die älteste Stadt Deutschlands zu unternehmen. Dieser Wunsch konnte dann am 27. Juni 2023 in die Tat umgesetzt werden. Pünktlich um 8.00 Uhr setzte sich unser Bus in Buchholz in Bewegung. Durch zahlreichen Zuspruch aus unserer Gruppe und mit einigen Gästen war der Bus gut besetzt, so dass es möglich war, die Fahrt zu einem moderaten Preis anzubieten.
Zunächst ging es über die Autobahn und dann durch die Eifel in Richtung Trier, wo wir wie vorgesehen gegen 11.30 Uhr eintreffen und unweit des Trierer Wahrzeichens, der Porta Nigra, aussteigen konnten.
Nach einer Pause für das Mittagessen gab es für alle irgendeine Möglichkeit, die Stadt kennen zu lernen. Wer nicht an der gebuchten Stadtführung teilnehmen wollte, konnte mit dem so genannten Römer-Express, einer kleiner Bimmelbahn, auf eigene Faust eine Stadtbesichtigung durchführen. Andere wiederum nutzten einen Doppeldeckerbus, der als „Hopp-on Hopp-off“-Bus die Möglichkeit bot, an verschiedenen Stellen auszusteigen, sich dort umzusehen und mit dem nächsten Bus weiterzufahren. Auch das Angebot für eine Panoramafahrt mit dem Schiff auf der Mosel wurde gerne angenommen.
Bei der Stadtführung unter der Bezeichnung „2000 Jahre – 2000 Schritte“, die wegen der großen Teilnehmerzahl in 2 Gruppen durchgeführt werden musste, wurden wir zunächst mit der Geschichte der Stadt bekannt gemacht Dabei blieb es natürlich nicht unerwähnt, dass die Römer hier vor 2000 Jahren eine Stadt namens Augusta Treverorum gründeten, woraus sich der heutige Name Trier ableitet. Dann wurde uns die Porta Nigra ausführlich beschrieben. Dabei handelt es sich um eines der ehemaligen römischen Stadttore. Etwa 1000 Jahre später ließ sich der aus Sizilien stammende Mönch Simeon als Einsiedler dort nieder. Er wurde nach seinem Tod im Jahr 1035 im Erdgeschoss der Porta Nigra bestattet und auf Betreiben des Trierer Erzbischofs, der ein Freund Simeons war, noch im gleichen Jahr heiliggesprochen. Danach diente sie über mehrere Jahrhunderte als Kirche, dazu wurde das Simeonsstift gegründet. Kirche und Stift wurden im Jahr 1802 durch Napoleon aufgehoben und gleichzeitig der Rückbau verfügt. Die Abbrucharbeiten wurden erst 1815 eingestellt, nachdem Trier durch den Beschluss des Wiener Kongresses an Preußen gefallen war. Seitdem ist nun wieder das römische Tor zu sehen. Seit 1986 ist die Porta Nigra zusammen mit anderen Bauwerken der Stadt UNESCO-Welterbe.
Über den Hauptmarkt mit dem Marktkreuz, dem Marktbrunnen und der Bürgerkirche St. Gangolf ging es dann weiter zum Dom. Die Anfänge des Doms reichen zurück bis in das 4. Jahrhundert, als man über den Resten eines repräsentativen römischen Wohnhauses eine Basilika errichtete, die schließlich zu einer der größten Kirchenbauten in Europa erweitert wurde. Wenn man vom Hauptmarkt auf den Dom zugeht, fallen bei einem Blick auf die Westfassade sofort die unterschiedlich hohen Türme auf. Dieser Unterschied erklärt sich daraus, dass der Erzbischof im frühen 16. Jahrhundert Anstoß daran nahm, dass die Domtürme vom Turm der Bürgerkirche St. Gangolf überragt wurden. Deshalb ließ er den Südwestturm des Doms, der nach jenem Erzbischof auch als „Greifenklau-Turm“ benannt wird, aufstocken und das Geläut erweitern, womit dann aus seiner Sicht die Ordnung wohl wieder hergestellt war (Anmerkung: In Osnabrück wurde ein Turm des Doms ebenfalls umgebaut und vorübergehend erhöht, weil es dem dortigen Bischof auch nicht gefiel, dass der Turm der Bürgerkirche St. Katharinen höher als die Domtürme war. Wer seinerzeit an unserer Fahrt nach Osnabrück teilgenommen hatte, wird sich vielleicht noch an die entsprechende Erläuterung des Stadtführers erinnern).
Die wohl bedeutendste Kostbarkeit, die im Dom aufbewahrt wird, ist der „Heilige Rock“. Damit ist die Tunika gemeint, die Christus getragen haben soll. Der Überlieferung zufolge wurde das Kleidungsstück von Helena, der Mutter Konstantin des Großen, nach Trier gebracht. Der Heilige Rock wird heute nur sehr selten und anlässlich von Wallfahrten öffentlich gezeigt. Bei unserer Stadtführung hatten wir im Dom die Gelegenheit, einen Blick auf den Schrein zu werfen, in dem der Heilige Rock aufbewahrt wird.
Direkt neben dem Dom erhebt sich die Liebfrauenkirche, die zusammen mit der Elisabethkirche in Marburg als die älteste gotische Kirche in Deutschland gilt. Das Portal der Kirche mit den figürlichen Darstellungen der Ecclesia (Kirche) und der Synagoge mit verbundenen Augen und einer zerbrochenen Thora-Rolle in der Hand macht deutlich, wie die christliche Kirche über viele Jahrhunderte hinweg das Judentum betrachtete.
Durch den Innenhof des Domkreuzgangs mit dem beeindruckenden „Adenauerblick“ verließen wir den Dom. Der „Adenauerblick“ erhielt dadurch seine Bezeichnung, als der frühere Bundeskanzler Adenauer anlässlich der Verleihung der Ehrenbürger-Würde durch die Stadt Trier von dieser Stelle aus das historische Gebäudeensemble mit dem Dom und dem Chor der Liebfrauenkirche besichtigte.
Das nächste Ziel unserer Stadtführung war die Konstantinbasilika, die heute offiziell „Evangelische Kirche zum Erlöser“ genannt wird. Dabei handelt es sich ursprünglich um eine römische Palastaula, die als Audienzhalle für die römischen Kaiser, die in Trier residierten, erbaut worden war. Diese Palastaula hatte sogar bereits eine Art Fußbodenheizung und war mit allen Annehmlichkeiten der damaligen Zeit ausgestattet. Im frühen Mittelalter kam die Ruine des Gebäudes in den Besitz der Erzbischöfe von Trier, die deren Reste im 17. Jahrhundert in die neue Bischofsresidenz oder auch das Kurfürstliche Palais integrieren ließen. Unter preußischer Herrschaft wurde das Gebäude als Kirche wieder hergestellt und der evangelischen Gemeinde „auf ewige Zeiten“ zur Nutzung übergeben. Eigentümer war jedoch nie die Evangelische Kirche, sondern immer der Staat. So ist auch heute noch das Land Rheinland-Pfalz als Rechtsnachfolger des ehemaligen Preußen Eigentümer der Basilika und für deren Unterhalt verpflichtet. Leider war die Kirche geschlossen und eine Besichtigung daher nicht möglich.
Während der Stadtführung wurden wir auch auf Karl Marx hingewiesen, der am 5. Mai 1818 in Trier geboren wurde und der bis heute wohl eine der bekanntesten und umstrittensten Persönlichkeiten der Stadt ist. Karl Marx war der Sohn eines jüdischen Rechtsanwaltes, der 1819 zum Protestantismus konvertierte und der erst mit diesem Schritt für eine Tätigkeit an einem preußischen Gericht zugelassen wurde. Zum 200. Geburtstag von Karl Marx im Jahr 2018 erhielt die Stadt Trier von der Volksrepublik China als Geschenk eine Statue, die den Philosophen zeigt. Diese Karl-Marx-Statue mit einer Gesamthöhe von 5,50 Metern zählt heute zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Sie steht unweit der Porta Nigra und der Stadtinformation und auch in Sichtweite des ehemaligen Wohnhauses der Familie Marx.
Nach der Führung mit den vielen Informationen war es doch sehr angenehm, ein Café besuchen zu können, bevor uns der Bus wieder zurück nach Duisburg brachte. Erfreulicherweise meinte es auch das Wetter gut mit uns, obwohl sich ab und zu einige Wolken am Himmel zeigten. So konnten wir insgesamt wieder auf eine schöne und gelungene Fahrt zurückblicken.
Manfred Winkler
Bilder: Roswitha Nieschulze, Edeltraud Walder, Irmgard Monderkamp, Reinhard Lorenz, Renate Müller, Ursula Niermann
Fahrt zur Gruga in Essen am 30. Mai 2023
Am Pfingstdienstag nutzten wir das schöne frühsommerliche Wetter und machten uns mit 16 Netzwerkern nach Essen zum Grugapark auf. Dort stellte sich zunächst die Frage, wofür denn der Name „Gruga“ steht. Der Name ist aus der Abkürzung für Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung abgeleitet, die 1927 und 1952 stattfand. Weiterhin fand an der gleichen Stelle die Bundesgartenschau 1965 statt.
Eine Fahrt mit der Parkeisenbahn auf ihrer 3,8 Kilometer langen Strecke verschaffte uns einen Überblick über die Größe der Parkanlage. Beete mit blühenden Frühjahrsblumen suchte man eigentlich vergeblich, dafür dominierte aber die Rhododendronblüte. Und die weiten Grünflächen hatten sich die Besucher des Parks zum Sitzen in der Sonne oder auch ihre Kinder zum Spielen zueigen gemacht.
Nach einer Kaffeepause besuchten wir dann das Gradierwerk, dessen 10 Meter hohe Saline nach der Internetseite des Grugaparks „zu einem kleinen Ausflug an die See“ einlädt. Die Bänke rund um das Gradierwerk „dienen einer gesundheitsfördernden Erholungspause“, und dieses Angebot wurde fand regen Zuspruch.
Wir hatten die Gruga in den vergangenen Jahren bereits mehrmals im Winter anlässlich des Parkleuchtens besucht, und so es war sehr interessant, den Park auch einmal bei Tageslicht kennenzulernen.
Manfred Winkler
Bilder: Christa Schneider, Ellen Kircher, Manfred Winkler
Fahrt nach Linz am Rhein am 2. Mai 2023
Wenn die Stadt Linz erwähnt wird, denkt man wahrscheinlich zuerst an die Landeshauptstadt des österreichischen Bundeslandes Oberösterreich, die an der Donau liegt. Aber es gibt auch eine Stadt mit gleichem Namen in Deutschland. Sie ist wohl wesentlich kleiner als die Stadt in Österreich, sie liegt in Rheinland-Pfalz, nicht weit entfernt von der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und schmückt sich mit dem Prädikat „Die Bunte Stadt am Rhein“. Sie wird auch oftmals als eine Fachwerkstadt bezeichnet. Und dieses Linz am Rhein, wohin wir uns am 2. Mai 2023 mit 30 Netzwerkern auf den Weg machten, war dieses Mal das Ziel unseres Ausflugs.
Das Wetter zeigte sich zunächst gar nicht frühlingshaft, der Himmel war grau verhangen, und auch die Temperaturen ließen zu wünschen übrig. Die vorsichtshalber mitgebrachten Regenschirme konnten jedoch in den Taschen bleiben, und später zeigte sich ab und zu sogar die Sonne.
Die bei unseren Ausflügen übliche Stadtführung begann auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Dort machte uns der Stadtführer auf den modernen bronzenen Ratsbrunnen aufmerksam, der die Demokratie darstellen soll. Das souveräne Volk, welches oben sitzt, überwacht und bestimmt die unten sitzenden Regierenden durch Drehen und Verstellen der Gelenke. Von dort aus ging es zum Rhein und zum Rheintor, das in früheren Jahren der Eingang zur Stadt war. Linz hatte ein Zoll- und Stapelrecht, wodurch die Stadt zu einem gewissen Wohlstand gelangte. Allerdings hat Linz auch von jeher Probleme, wenn der Rhein Hochwasser führt. An den Hochwassermarken an der Außen- und Innenseite des Rheintors kann man an den verschiedenen Markierungen erkennen, wie hoch das Wasser schon gestanden hatte. Dass das Wasser dann auch noch bis in die Innenstadt steht, kann man an einem Fachwerkhaus unweit des Rheintors erkennen, wo es im ersten Stock eine Tür mit der Aufschrift „Notausgang bei Hochwasser“ gibt. Direkt neben dem Rheintor befindet sich der Burgplatz mit der Burg Linz aus dem 14. Jahrhundert, die der Kölner Erzbischof, der damals der Landesherr war, als Zoll- und Zwingburg erbauen ließ. Normalerweise befinden sich Burgen ja an erhöhter Stelle. Wie uns unser Stadtführer erklärte, sollte jedoch mit dieser Burg die Macht des Kölner Erzbischofs über die Stadt demonstriert werden. Auf einem Brunnen in der Mitte des Burgplatzes steht die Figur des „Linzer Strünzer“, der ein Symbol für den Ur-Linzer sein soll. Dieser neigte wohl gerne zu Übertreibungen und Beschönigungen, insbesondere was ihn und sein Hab und Gut anging.
Weiter ging es durch die Altstadt an verschiedenen Fachwerkhäusern vorbei. Unter anderem wurden wir auf ein Haus aufmerksam gemacht, bei dessen Bau keine Nägel verwendet worden waren, oder auch auf das schmalste Haus der Stadt, welches in den Zwischenraum von zwei bereits bestehenden Fachwerkhäusern gebaut worden ist. Zwischendurch wurden wir von unserem Stadtführer aufgefordert, die Einwohnerzahl der Altstadt zu schätzen. Zu unserem Erstaunen erfuhren wir, dass die Altstadt von Linz lediglich etwa 350 Einwohner zählt. Dann wurden wir gefragt, ob jemand von uns die an einer Hausfassade stehende, offensichtlich lateinische Inschrift „Situs vilate in ise te vernit“ übersetzen könne. Niemand von uns war dazu in der Lage, und es wurde der Humor des Erbauers deutlich: Diese Inschrift ist kein Latein, sondern heißt letztendlich aus der rheinischen Mundart übersetzt: „Sieht aus wie Latein, ist es aber nicht“. Nebenbei erfuhren wir auch, dass Linz am Rhein und Linz an der Donau Partnerstädte sind, was unter anderem an dem Straßennamen „An der Donau“ deutlich wird.
Unser Weg führte uns dann zum Buttermarkt mit einem Brunnen und dem Denkmal der Marktfrau Agnes. Dieses Denkmal wurde 1986 zum Gedenken an die Landfrauen vom Westerwald und aus den Dörfern rechts und links des Rheins errichtet, die auf dem Buttermarkt ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse anboten. Diese Frauen hatten dabei teilweise Fußmärsche von bis zu 20 Kilometern zurückzulegen.
Auf unserem weiteren Weg wurde uns ein repräsentatives Fachwerkhaus gezeigt, dessen Erbauer ein jüdischer Kaufmann war, der die Erlaubnis bekommen hatte, in der Stadt zu wohnen. Direkt hinter dem Haus stand die Synagoge, die während der Pogromnacht im November 1938 zwar nicht angezündet worden war, weil man um die dicht bebaute angrenzende Altstadt fürchtete, aber dennoch zerstört wurde. Eine schlichte Gedenktafel erinnert an dem heute dort stehenden Haus, dass sich an dieser Stelle einst das jüdische Gotteshaus befand. Und vor dem gegenüberliegenden Gebäude erinnert ein Stolperstein daran, dass es sich dabei um das ehemalige sogenannte Judenhaus handelte, in dem sich die wenigen verbliebenen jüdischen Einwohner bis zu ihrer Deportation aufzuhalten hatten.
Einige Minuten später erreichten wir das Neutor, wo unsere Stadtführung endete. Das Neutor ist das östlichste Stadttor der ehemaligen Stadtmauer. Vor dem Tor steht eine Bronzeplastik des „Linzer Klapperjungen“. Das „Klappern“ stellt einen alten Brauch dar. Es wird durch das Schütteln eines Holzbretts mit einem darunter befestigten Hammer erzeugt und ersetzt in katholisch geprägten Gegenden an den Tagen der Karwoche, an denen die Kirchenglocken schweigen, das Geläut. Wie uns unser Stadtführer erläuterte, ist dieser Brauch auch in Linz wieder aufgelebt und wird inzwischen von mehr als 200 Menschen durchgeführt.
Mit dem schon beinahe traditionellen Cafébesuch nach der Stadtführung beendeten wir unseren Besuch in der „Bunten Stadt am Rhein“.
Manfred Winkler
Fahrt nach Kevelaer am 4. April 2023
Das Ziel unseres Ausflugs am 4. April 2023 war der Wallfahrtsort Kevelaer. Dazu machten wir uns mit 29 Netzwerkern auf den Weg. Obwohl die Temperaturen noch nicht so frühlingshaft waren, schien dennoch die Sonne von einem strahlend blauen Himmel, so dass die vorsorglich mitgebrachten Regenschirme in den Taschen bleiben konnten. Auch die oftmals wegen ihrer Unzuverlässigkeit gescholtene Deutsche Bahn brachte uns pünktlich an unser Ziel und auch ebenso am Abend wieder zurück.
Nachdem wir uns zunächst einmal in der kleinen Stadt ein wenig umgesehen und uns gestärkt hatten, begann am Rathaus unsere Stadtführung. Zunächst erfuhren wir, wie sich Kevelaer im Laufe der Zeit entwickelt hat. Kevelaer ist bis heute der nördlichste Marienwallfahrtsort in Deutschland und seit Errichtung der Gnadenkapelle auf dem heutigen Kapellenplatz das Ziel vieler Pilger. Durch den Anschluss des Ortes an die Eisenbahn erhöhte sich deren Anzahl beträchtlich. Wie uns unser Stadtführer berichtete, hatte der heute sehr bescheiden wirkende Bahnhof von Kevelaer damals 11 Gleise, wo die Sonderzüge, mit denen die Pilgergruppen anreisten, bis zu deren Abfahrt abgestellt wurden. Vor der Corona-Pandemie sollen jährlich zwischen 800.000 und 1 Million Pilger gekommen sein. Nach der Pandemie rechnet man wieder mit ungefähr 500.000 Pilgern pro Jahr, aber selbst diese Zahl würde bedeuten, dass während der Pilgersaison zwischen dem 1. Mai und dem 1. November täglich durchschnittlich eine 4-stellige Anzahl von Gläubigen in die Stadt kommt.
1975 wurden im Rahmen der Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen die ehemals selbständigen Orte Kervenheim, Wetten und Winnekendonk zur Stadt Kevelaer eingemeindet, was wohl bis heute in diesen Gemeinden nicht allgemeine Zustimmung findet.
Danach ging es über einen Platz mit einem sehr schönen modernen Brunnen aus schwarzem Marmor hinüber zur St. Antonius-Kirche. Diese Kirche wurde durch einen Brandschaden im Jahr 1982 beinahe völlig zerstört. Beim Wiederaufbau wurde auf den ursprünglich neugotischen Baustil verzichtet, und der Innenraum wurde in eine helle, großzügig wirkende Halle umgestaltet. Anschließend führte uns der Weg durch die Fußgängerzone der Innenstadt zum Kapellenplatz. Hier erklärte uns der Stadtführer, dass wir das weltliche Zentrum der Stadt verlassen hätten und uns nun im geistlichen Zentrum befinden. Auf der einen Seite des Platzes steht die Kerzenkapelle, und auf der anderen Seite erhebt sich die Marienbasilika. Mittelpunkt des Kapellenplatzes ist die Gnadenkapelle mit dem Gnadenbild.
Zur Entstehung der Wallfahrt hörten wir von unserem Stadtführer, dass dort, wo sich heute die Gnadenkapelle befindet, ein Hagelkreuz gestanden hatte. Der Händler Hendrick Busmann, der dort auf seinem Weg von Weeze nach Geldern zum Gebet verweilte, will im Jahr 1641 dabei dreimal an verschiedenen Tagen die Aufforderung gehört haben: „An dieser Stelle sollst Du mir eine Kapelle bauen“. Seine Frau erhielt später das auf dem damals sehr teuren Papier gedruckte Marienbild, welches dann 1642 in den von Hendrick Busmann erbauten Bildstock eingesetzt wurde. Die heutige Gnadenkapelle im Stil des Barock wurde 1654 um den Bildstock herum gebaut. Das Gnadenbild wurde seitdem das Ziel vieler Pilger, und da es an dieser Stelle von der katholischen Kirche anerkannte Wunderheilungen gab, wurde Kevelaer auch sehr früh zum Wallfahrtsort. Wie uns der Stadtführer erläuterte, gab es die letzte dokumentierte Wunderheilung im Jahr 1953. Damals wurde eine an multipler Sklerose erkrankte, bereits austherapierte Patientin auf ihren Wunsch nach Kevelaer gebracht, die dann nach dem Besuch des Gnadenbildes gesund wurde. Die Genesung wurde von der Universitätsklinik in Aachen bestätigt und von der Kirche als Wunder anerkannt.
Die Kerzenkapelle, die wir zuerst besuchten, ist die älteste Kirche am Kapellenplatz und erhielt ihren Namen durch die vielen Kerzen, die sowohl im Innenraum als auch außen am Seitenschiff zu sehen sind. Im Inneren sind es vor allem die Kerzen, die die Pilgergruppen auf ihrem Weg nach Kevelaer mitbringen, außerdem befinden sich dort zahlreiche Andenkentäfelchen sowie Wappen- und Danksagungsschilder.
Anschließend besichtigten wir die Gnadenkapelle mit dem Gnadenbild und danach die Wallfahrtsbasilika mit der größten romantischen Orgel in Deutschland. Dort erfuhren wir von unserem Stadtführer, dass Papst Johannes Paul II bei seinem Deutschlandbesuch im Jahr 1987 auch Kevelaer besuchte und dort am 1. Mai durch 3 Schläge mit einem silbernen Hammer gegen das Kirchenportal die Pilgersaison eröffnete. Ein Relief an einer Tür der Kirche zeigt dieses denkwürdige Ereignis. Mit dem Besuch der Wallfahrtsbasilika endete unsere wieder einmal sehr interessante und informative Stadtführung.
Mit einem Cafébesuch und einem anschließenden kurzen Stadtbummel ließen wir unseren Ausflug nach Kevelaer ausklingen.
Manfred Winkler
Bilder: Roswitha Nieschulze, Imgard Monderkamp, Reinhard Lorenz, Manfred Winkler
Fahrt zum Ruhrmuseum im Welterbe „Zollverein“ in Essen
am 28. Februar 2023
Das Ruhrmuseum auf der Zeche „Zollverein“ in Essen war am 28. Februar Ziel unseres ersten Ausflugs im Jahr 2023. Dabei stand der Besuch der Ausstellung „Hände weg vom Ruhrgebiet! Die Ruhrbesetzung 1923 – 1925“ im Mittelpunkt.
Diese Ausstellung erinnert an den 100. Jahrestag, als französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet besetzten, da nach Ansicht ihrer Regierungen das Deutsche Reich mit den im Versailler Friedensvertrag von 1919 geforderten Reparationen nicht nachkam. Dazu gehörten unter anderem auch Kohlelieferungen, da die deutschen Truppen bei ihrem Rückzug während des ersten Weltkriegs die Kohlengruben in Nordfrankreich und Belgien geflutet hatten, so dass diese nicht produzieren konnten und damit die Energieversorgung nicht gesichert war.
So besetzten am 11. Januar 1923 französische Kavallerie und belgische Fahrradtruppen das Ruhrgebiet und griffen mit zahllosen Verordnungen in das Leben der deutschen Zivilbevölkerung ein. Die wiederum empfand den Einmarsch sowie die harten Bedingungen des Versailler Vertrages ohnehin als ungerecht und reagierte ihrerseits mit heftigem Widerstand. So weigerten sich die Eisenbahner, Kohlenzüge in Richtung Frankreich abzufertigen. Daraufhin versuchten die Franzosen, mit eigenen Eisenbahnern in ihrer Regie die Transporte abzuwickeln, was allerdings aufgrund des komplexen Signal- und Gleissystems zu Problemen und etlichen Unfällen führte. Und da die französischen Eisenbahner Wohnraum benötigten, wurden zahlreiche deutsche Eisenbahner in nicht besetzte Gebiete ausgewiesen.
Etwa 200 Exponate wie z. B. Fotografien, Postkarten, Plakate, Gedenktafeln, aber auch Waffen und Uniformen, erinnern an diese Zeit. Die damalige Stimmung auf beiden Seiten lässt sich auch an der Propaganda wie z. B. einigen Flugblättern erkennen, aus denen an den teilweise bösartigen Darstellungen der gegenseitige Hass ersichtlich wird. Weiterhin sind unter anderem auch noch gut erhaltene Zeitungsartikel zu sehen, in denen von dem „Essener Blutsamstag“ sowie von der „Dortmunder Bartholomäusnacht“ berichtet wird. Bei dem „Essener Blutsamstag“ wollten französische Soldaten die Lastwagen der Firma Krupp beschlagnahmen, und als sich die Arbeiter sowie die Werksleitung weigerten, fielen von Seiten der Soldaten Schüsse, bei denen 13 Arbeiter ums Leben kamen. Der „Dortmunder Bartholomäusnacht“ war vorausgegangen, dass 2 Soldaten von Heckenschützen erschossen worden waren. Daraufhin verhängten die französischen Besatzer eine nächtliche Ausgangssperre. Zahlreiche Dortmunder, die einen Sonntagsausflug ins Umland gemacht hatten, erhielten von dieser Maßnahme nicht mehr rechtzeitig Kenntnis. Darunter waren sechs Männer aus Dortmund und ein Schweizer Staatsbürger, die bei ihrer Rückkehr wegen Nichteinhaltung dieser Ausgangssperre ohne Vorwarnung von französischen Soldaten niedergeschossen wurden.
Allerdings erfuhren wir auch von einem anderen Ereignis, das als das „Dattelner Abendmahl“ in die Geschichte der Ruhrbesetzung eingegangen ist. Der französische Offizier Etienne Bach, Sohn eines Pfarrers aus dem Elsass, besucht am Karfreitag 1923 den Gottesdienst im Lutherhaus in Datteln. Als bei der Abendmahlsfeier die Gottesdienstbesucher vom Pfarrer zu einem Zeichen des Friedens aufgefordert werden, steht ihm der deutsche Vertreter des Amtes Datteln gegenüber, der ihm bisher heftigen Widerstand entgegengesetzt hatte. Beide reichen sich die Hand und versprechen, einander künftig als Christen zu respektieren und zum Wohl der Bevölkerung miteinander im Gespräch zu bleiben. Etienne Bach sagte dazu später, dass von jenem Tag an Frieden zwischen ihnen beiden herrschte und dass es die ganze Stadt hätte spüren können. Im Jahr 1963 stiftet Etienne Bach anlässlich eines Besuchs in Datteln der Luthergemeinde zur Erinnerung einen Abendmahlskelch, der auch Gegenstand der Ausstellung ist.
Abschließend erfuhren wir zu unserem großen Erstaunen von unserem Guide, dass die letzte Rate der Kriegsschulden aus dem
ersten Weltkrieg von Deutschland erst im Jahr 2010 beglichen wurde. Dazu gibt es einen Zeitungsartikel der Rheinischen Post, der unter dem folgenden Link abgerufen werden kann:
https://rp-online.de/politik/deutschland/deutschland-bezahlt-letzte-kriegsschulden_aid-12622347
Wie wir weiterhin erfuhren, hat man selbst von Seiten der Veranstalter nicht mit einem derart großen Interesse an der Ausstellung gerechnet.
Es dürfte sich vielleicht sogar lohnen, diese sehenswerte Ausstellung noch einmal für sich zu besuchen und sich so nochmals ein genaueres Bild von einem wesentlichen Teil der Geschichte des Ruhrgebiets zu machen.
Manfred Winkler
Bilder: Roswitha Nieschulze, Imgard Monderkamp, Renate Müller, Christa Schneider
Unsere Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Bremen am 13. Dezember 2022
Das Ziel unserer letzten Fahrt im Jahr 2022 war der Weihnachtsmarkt in Bremen. Für diese Fahrt hatten wir die Möglichkeit des Sparpreises bzw. des Supersparpreises der Deutschen Bahn für Gruppen im Fernverkehr ausprobiert, und das mit einem guten Erfolg, wenn man einmal von der mehr als 1-stündigen Verspätung auf der Hinfahrt absieht. Die angemeldeten Teilnehmer kamen zu einem sehr günstigen Preis nach Bremen und auch wieder zurück nach Duisburg..
Das Wetter in Bremen war dem Anlass entsprechend: trocken, sonnig und kalt, also für den Weihnachtsmarkt geeignetes Glühweinwetter. Natürlich wurde der große Marktplatz mit dem Dom, dem Rathaus und dem Roland besucht, und dabei durften selbstverständlich die Bremer Stadtmusikanten nicht fehlen, ebensowenig wie ein Besuch im Schnoorviertel.
Ansonsten möchten wir die Bilder von der Innenstadt, dem Schnoorviertel und der Schlachte mit ihren Eindrücken wirken lassen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle Mitfahrer von dieser Fahrt sehr angetan waren.
Manfred Winkler
Bilder: Roswitha Nieschulze, Doris Winkler
